Drei Mythen über die Corona-Krise. Teil Drei.
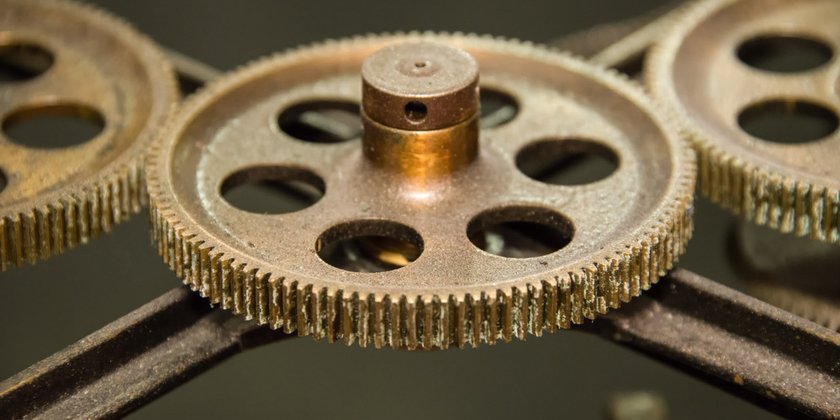 Flickr
Flickr
Die Corona-Pandemie bringt für uns konstant Veränderungen mit sich: Im Tages- oder im Wochentakt werden neue Bedingungen und Regeln aufgestellt. Die meisten von uns verfolgen die Entwicklungen mehr oder weniger regelmäßig und versuchen, die Ereignisse und damit auch mögliche Szenarien der Krisenbearbeitung durch die Herrschenden einzuordnen und zu analysieren. Dabei gibt es auch Annahmen und Mystifizierungen, die es (zum aktuellen Zeitpunkt) zu hinterfragen und zu diskutieren gibt. Dieser Beitrag ist der Auftakt einer Reihe zum Thema. Obwohl sich einige der Aussagen sicher verallgemeinern lassen, beziehen sich die folgenden Überlegungen in erster Linie auf die Bundesrepublik Deutschland.
Mythos 3: Um die Krise zu überwinden, müssen wir alle den Gürtel enger schnallen. Wenn wir jetzt verzichten können, wird es uns bald wieder besser gehen.
Gerade in Krisenzeiten wird gern die Floskel „Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut“ in verschiedenen Ausformungen wiederholt. In der Corona-Pandemie wird das durch die Phrase ergänzt, wir alle wünschten uns eine baldige Rückkehr zur Normalität. Diese beiden Wunschgedanken bedürfen einer grundlegenden Kritik.
Ein gutes Leben für alle?
Was bedeutet es eigentlich, dieses „es geht uns allen gut“? Heißt es, dass wir alle einen Job haben, ein ausreichendes Einkommen und einigermaßen sichere Zukunftsaussichten? Dann ließe sich konstatieren, dass diese Lebensumstände im Kapitalismus selbst in wirtschaftlichen Konjunkturphasen bei Weitem nicht auf alle und spätestens seit dem Finanzcrash von 2008 und im Zuge des neoliberalen Umbaus wohl auch insgesamt für immer weniger Menschen zutreffen. Außerdem ignoriert diese Auffassung eines „guten Lebens“ die massive Beschneidung unserer Freiheit im und durch das Arbeitsleben: Wir müssen unsere Zeiteinteilung und gesamte Lebensplanung kapitalistischen Sachzwängen unterwerfen.
Eine freie Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung im Sinne eines guten Lebens sind kaum möglich: Viele von uns müssen Arbeiten verrichten, die sie nicht tun wollen, die sie körperlich und psychisch zermürben und krank machen. Wir lernen, uns und unsere Arbeitskraft im Berufsleben trotzdem zu selbst wie eine Ware zu verkaufen – vom Bewerbungsgespräch bis zur Profilierung vor Kolleg*innen und Chef*innen - um im Konkurrenzkampf nicht unterzugehen. Während der Arbeitszeit, also einem meist erheblichen Teil unserer Lebenszeit, sind wir fremdbestimmt. Unser*e Arbeitgeber*in entscheidet, welche Tätigkeiten wir wann und wie auszuführen haben. Demokratische Prinzipien gibt es in der Arbeitswelt kaum und auch, wenn sich manche Unternehmen gern den Anstrich flacher Hierarchien geben, bleiben Vorgesetzte doch immer Vorgesetzte, die die Grenzen unserer Selbstbestimmung von oben festlegen und sich den täglich durch unsere Arbeit geschaffenen (Mehr.)Wert aneignen.
Der im Kapitalismus strukturell unter diesem Wert liegende Lohn, der am Ende des Monats auf unserem Konto landet, dient im Wesentlichen der Reproduktion unserer Arbeitskraft, die wir dem Unternehmen schließlich auch noch im nächsten Monat gewinnbringend verkaufen können sollen. All das sind nur einige der täglichen Zumutungen des kapitalistischen Systems für unsere Leben. Mit anderen Worten: Im Kapitalismus geht es uns nie „gut“. Die reale Verschlechterung unserer Lebensverhältnisse, etwa durch steigende Zahlen derjenigen, die „arbeitslos“, also ohne entlohnte Arbeit sind, Kurzarbeit, steigende Lebenshaltungskosten bei gleichbleibenden Hartz4-Sätzen und sinkenden Löhnen, kommt durch die Corona-Krise nun zum bestehenden Stress noch dazu. Und wenn nun in der Pandemie darauf verwiesen wird, dass es uns allen gut geht, wenn es der Wirtschaft gut geht, dürfen wir nicht der Illusion verfallen, das Kapital würde irgendwelche sozialen Interessen verfolgen.
Das liegt gar nicht in seiner Logik. Im Gegenteil: Der Kapitalismus und darin das Kapital profitiert zum Beispiel von einer gewissen Zahl an Erwerbslosen, die in relativer Verelendung leben und die schon Marx als „industrielle Reservearmee“ bezeichnete. Sie dienen – wie auch Hierarchisierungen von Arbeiter*innen auf dem globalen Markt (bei der Ausbeutung von migrantischen Arbeiter*innen zum Beispiel) – zugleich als abschreckendes Beispiel („Seht, wie schlecht es euch erginge, wenn ihr nicht fügsam der für euch vorgesehenen Arbeit nachgeht!“), der Lohndrückerei und als tatsächliche Rücklage von Arbeitskraft, auf die in Zeiten des Aufschwungs zurückgegriffen werden kann. Sozialstaatliche Zuwendungen erfüllen dabei die Funktion, die potenziellen Arbeitskräfte in einem einigermaßen tauglichen Zustand zu halten, damit sie bei Bedarf verwertbar sind. Eine hohe Beschäftigungsquote und ein steigender Lebensstandard sind allenfalls Nebenprodukte der Kapitalverwertung, auf die keinerlei Verlass ist.
Die Normalität heißt Verwertung
Krisen stellen unsere sicher geglaubten Erwartungen für die Zukunft infrage. In so einer Situation ist nachvollziehbar, dass der Wunsch nach mehr Vorherseh- und Planbarkeit des Lebens aufkommt. Der Kapitalismus bietet uns, ganz einfach indem er seiner ihm innewohnenden Verwertungslogik folgt und uns durch immer neue Unwetter oder einfach durch den täglichen Nieselregen peitscht, diese Sicherheit aber so oder so nicht. „Das Einzige, das in diesen ökonomischen Stürmen gewiss ist, ist die Ungewissheit“ (Heinrich 2018: 175). Zu welcher Art Normalität sollten wir also zurückwollen? Wenn Politiker*innen davon sprechen, dass wir alle uns eine „Rückkehr zur Normalität“ wünschen, meinen sie vor allem, dass die infolge der Krise verschlechterten Kapitalverwertungsmöglichkeiten wieder verbessert werden sollen. Für den Staat ist das wichtig, weil er vom Kapital abhängig ist. Staatliche Strukturen, Investitionen und Institutionen werden durch Steuergelder finanziert, welche die Unternehmen vom Reichtum, den die Lohnabhängigen für sie erarbeiten, abführen. Staat und Kapital stehen in einer Wechselbeziehung. Insbesondere in der aktuellen Gesundheitskrise muss der Staat Leben und Gesundheit der Arbeiter*innen, die Wertbasis der kapitalistischen Demokratie, schützen. Aber nur insofern es dem kapitalistischen Gesamtinteresse dient.
Die Ausrichtung der Politik an kapitalistischen Interessen statt an hehren Prinzipien zeigt sich nur allzu deutlich daran, dass die Arbeitsbedingungen in großen Betrieben, zum Beispiel in der Fleischindustrie, als Infektionstreiber von der Politik ausgeklammert werden und aus der medialen Öffentlichkeit weitgehend verschwunden sind. Die Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens hat Vorrang – koste es, was es wolle. Corona-Einschränkungen werden – in der zweiten Welle noch massiver – fast ausnahmslos in den privaten, sozialen und kulturellen Bereich verlegt. Die Jugend, die als Masse durchweg egoistischer Party-Monster inszeniert wird, ist der willkommene Sündenbock, um diese Politik zu rechtfertigen. Dabei wird auf valide Belege für diese homogene Darstellung ebenso gern verzichtet wie auf den Hinweis, dass durchaus auch ältere Menschen trotz Pandemie Feiern veranstalten und so weiter.
Abseits des Privaten hingegen sollen wir uns in volle Bahnen quetschen, uns acht Stunden lang neben unsere Kolleg*innen an den Schreibtisch setzen, mit Dutzenden von ihnen am Fließband stehen oder unsere Tage in schlecht gelüfteten Klassenzimmern verbringen (der Kapitalismus braucht gebildete kommende Generationen). Trotz exponentiell steigender Fallzahlen durften wir unser Geld abends noch über viele Wochen hinweg im Restaurant lassen – auch die Gastronomie ist eine wichtige Branche, was die aktuellen Debatten und Proteste um die weitgehenden Schließungen nochmal deutlich machen – uns aber bitte nicht im Park treffen. Neben der erschwerten Kontrollierbarkeit von Abstandsregeln sind derlei Freizeitaktivitäten auch einfach wirtschaftlich schlecht verwertbar und erscheinen daher aus der Perspektive der Politik am ehesten verzichtbar. Nachweislich hilft eine Reduktion der Kontakte, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Eben dieser Argumentation folgend ist es nicht nachvollziehbar, dass das für die Kontakte im Arbeitsalltag nicht gelten soll. Es ist mehr als offensichtlich, dass es nicht um uns, unsere Bedürfnisse und unsere Leben geht, sondern unsere Gesundheit nüchtern gegen Kapitalinteressen abgewogen wird.
Es rettet uns kein höh’res Wesen…
Ziel der aktuellen Politik ist nicht, das Leid, das der Kapitalismus für die meisten Menschen bedeutet, zu mindern, sondern es so rasch wie möglich auf den Prä-Corona-Stand zu bringen. Die alltägliche Missachtung unserer körperlichen und psychischen Gesundheit ist für uns außerhalb der Verschärfungen in der Corona-Krise weniger fühlbar und damit auch „normal“ geworden. Nur deshalb ist es leicht, uns vorzugaukeln, zu diesem Zustand zurückzukehren sei wünschenswert. Im Moment lassen sich damit sogar Wähler*innenstimmen gewinnen. Genaugenommen wird versucht, auf dieser Grundlage die Lohnabhängigen die Krise austragen zu lassen. Real- und Nominallöhne sinken, während die Vermögen der Superreichen – wie in fast jeder Krise – weiter wachsen; große Konzerne werden aufwändig gerettet, während kleine Betriebe, Kleinselbstständige und Kollektive in die Röhre schauen.
Die Profiteure einer Krise sind selten die Arbeiter*innen. Der Kapitalismus ist in seinem Wesen krisenhaft: Betrachtet man die materiellen Verhältnisse, die er schafft und stetig reproduziert, ist seine „Rettung“ für den größten Teil der Menschen keineswegs erstrebenswert. Warum sollten wir diese neuerliche Krise der kapitalistischen Warenwirtschaft ausbaden, beeinträchtigt sie doch unsere Leben jeden Tag?! Parolen wie „Capitalism is the crisis“ oder „The virus is capitalism” haben deshalb aktuell zu Recht Hochkonjunktur, weil sie auf diesen Umstand verweisen. Bei entsprechendem politischen Willen gäbe es weitaus bessere Möglichkeiten, die Krise finanziell abzufedern: zum Beispiel Vermögens- und Erbschaftssteuern, stark progressive Einkommenssteuer oder Enteignungen. Stattdessen werden zum Beispiel durch die Senkung der Mehrwertsteuer in erster Linie weiter diejenigen bevorteilt, die ohnehin schon über komfortablere finanzielle Möglichkeiten verfügen. Was bringt es uns, beim Kauf eines Neuwagens soundso viel sparen zu können, wenn wir ihn uns eh nicht leisten können? Abgesehen davon, dass es den Unternehmen überlassen ist, ob sie die Steuersenkung überhaupt weitergeben oder sich selbst noch mehr bereichern. „Wir sitzen alle im selben Boot“ trifft also nur insofern zu, als das „wir“ nicht die Herrschenden und die Beherrschten, die Kapitalist*innen und die Lohnabhängigen zusammen meint, sondern nur uns, die wir weitestgehend vom Reichtum der kapitalistische Warenwirtschaft ausgeschlossen sind.
Die Krise gemeinsam zu schultern, kann nicht heißen, dass wir uns noch mehr vom Mund abzusparen müssen. Vielmehr heißt es, gemeinsame soziale Proteste gegen die Belastungen, die auf uns abgewälzt werden, zu organisieren, uns in Arbeitskämpfen nicht gegeneinander ausspielen zu lassen und die Reichen und Kapitalist*innen zur Kasse zu bitten. Wenn jemand den Gürtel enger schnallen muss, dann sie! Diese Form der Politik wird uns nicht von oben geschenkt, wir müssen sie von unten erkämpfen. Auch in Zeiten von Corona.
Weiterführende Literatur:
Heinrich, Michael (2018): Kritik der politischen Ökonomie: eine Einführung in „Das Kapital“ von Karl Marx. Reihe Theorie.org. Stuttgart: Schmetterling Verlag.



